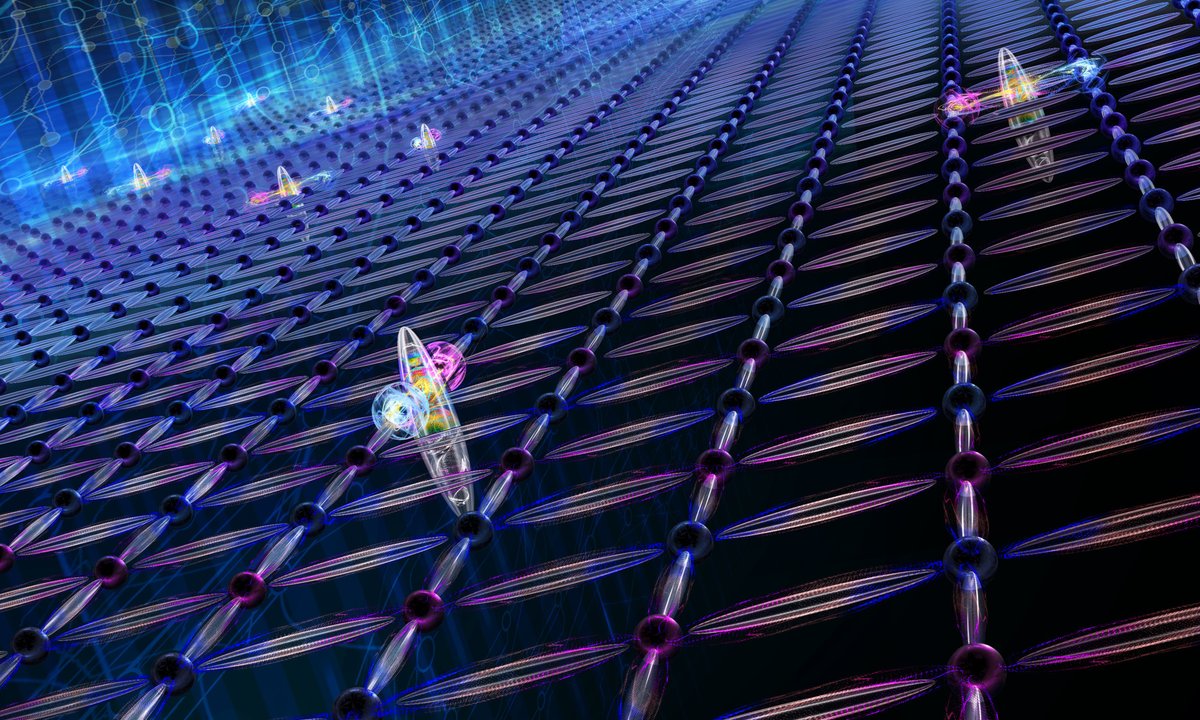Städte wachsen, ländliche Gebiete verlieren Einwohner: Dass immer mehr Menschen in Städten wohnen wollen, fordert weltweit Städteplaner, Politiker und nicht zuletzt alteingesessene Bewohner. Der Innsbrucker Geograph Andreas Haller, PhD vom ÖAW-Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung hat sich die Verstädterung in den Anden näher angesehen. „Die peruanische Großstadt Huancayo hat in der Agglomeration heute rund 425.000 Einwohner, wobei diese Zahl erst in den vergangenen 20 Jahren geradezu explodiert ist. Das hat Folgen für die zahlreichen Kleinbauern in der Gegend“, erklärt Haller. Im Rahmen des mehrjährigen, vom FWF geförderten Projekts „Rapid Urban Growth in the Andes“ hat er sich gemeinsam mit Prof. Axel Borsdorf Huancayo und die Bauern aus der Umgebung näher angesehen; im jüngsten, dieses Jahr im Rahmen des Projekts erschienen wissenschaftlichen Aufsatz hat er erstmals auch die Stimmung unter den Zuzüglern und deren Verständnis für die Probleme der Bauern abgefragt.
Peruanische Andenstadt
Huancayo liegt auf rund 3.300 Metern Seehöhe im zentralen Hochland Perus in den Anden. Die Lage in den Tropen erlaubt es, auch auf dieser Seehöhe noch Landwirtschaft zu betreiben – das extreme Bevölkerungswachstum führt aber dazu, dass immer mehr Bauland gebraucht wird und so landwirtschaftlich nutzbare Flächen verloren gehen. „In vorangegangenen Studien haben wir Satellitenbilder ausgewertet und uns die Probleme der Bauern in qualitativen Interviews mit ihnen näher angesehen“, sagt Andreas Haller. Insgesamt haben die betroffenen Bauern 20 Problemfelder genannt, die sie direkt oder indirekt treffen und die auftreten, weil die Stadt so rasch wächst: Etwa Einkommensverluste, weniger landwirtschaftlich nutzbarer Raum im Tal und die Tatsache, dass sie in immer höhere Lagen ausweichen müssen. In der jüngsten Studie zeigt sich, dass die Zuzügler durchaus Verständnis für die Probleme der Bauern haben: „Etwas überrascht hat uns, dass das Verständnis doch recht groß zu sein scheint – die neuen Bewohner am Stadtrand Huancayos haben von sich aus 13 der 20 Problemfelder genannt, sie sehen also durchaus, dass die Bauern darunter leiden, wenn sich die Stadt immer weiter ausbreitet.“ Allerdings gibt es auch Missverständnisse: So geben viele Zuzügler an, dass es für die Bauern durchaus profitabel sei, wenn die Stadt wächst – sie könnten ihren Grund teuer verkaufen. „In der Tat sind die Grundstückspreise in Huancayo enorm gestiegen: Ein Quadratmeter hat vor zwölf Jahren noch umgerechnet rund 0,3 US-$ gekostet, heute kriegt man 500 US-$ dafür“, erklärt der Geograph. Von diesem mehr als tausend Mal so hohen Wert haben die Bauern allerdings wenig: Sie besitzen nur selten selbst Grund und wenn, dann nur sehr kleine Flächen – die meisten Bauern sind hauptsächlich Pächter.
In die neuen Stadtteile ziehen hauptsächlich Angehörige der oberen Mittelschicht. So profitieren die Bauern im umliegenden Gebiet zwar von der harten Infrastruktur – Straßen, Kanalisation, Strom –, die weiche Infrastruktur, vor allem Bildungseinrichtungen, bleibt ihnen aber weitgehend vorenthalten: „In San Carlos, dem neuen Stadtteil, den ich mir unter anderem näher angesehen habe, hat sich eine ganze Reihe von Privatschulen, –kindergärten und –universitäten angesiedelt – die Bauern können sich diese Infrastruktur meist aber einfach nicht leisten.“
Regionale Produkte
Mehrere Bewohner der neuen Stadtteile sehen vor allem die regionale Produktion von Lebensmitteln gefährdet – und es gibt Unterschiede zwischen ganz neu Zugezogenen und den „Pionieren“ in den neuen Vierteln: „Menschen, die zwar den Bauboom mit ausgelöst haben, aber inzwischen schon mehrere Jahre in den neu urbanisierten Vierteln leben, sehen die Lage kritischer als jene, die erst seit kurzem dort wohnen. Sie sind wegen des Grünraums nach San Carlos gezogen, inzwischen wird aber auch dort immer dichter gebaut und Immobilienentwickler kaufen reihenweise Gründe auf“, erklärt Andreas Haller.
Dass es aber grundsätzlich Sympathien für die Bauern gibt, stimmt den Geographen zuversichtlich: „Natürlich können wir nicht in die Zukunft blicken, aber die doch recht deutliche Empathie für die Probleme der Bauern ist ein gutes Zeichen. Die Bauern selbst sind nämlich schlecht organisiert und werden zum Beispiel im neuen Stadtentwicklungsplan gar nicht als Interessensgruppe genannt.“ In diesem Plan kommen die spezifischen Probleme der Bauern deshalb auch nicht vor, der Schutz landwirtschaftlicher Flächen wird als allgemeines Ziel allerdings genannt. „Ein weiter reichendes Ziel müsste sein, die Kleinbauern in entsprechende Planungen einzubeziehen und ihnen eine Stimme zu geben. Zumindest die Bewohnerinnen und Bewohner der neuen Stadtteile hätten durchaus Verständnis dafür.“