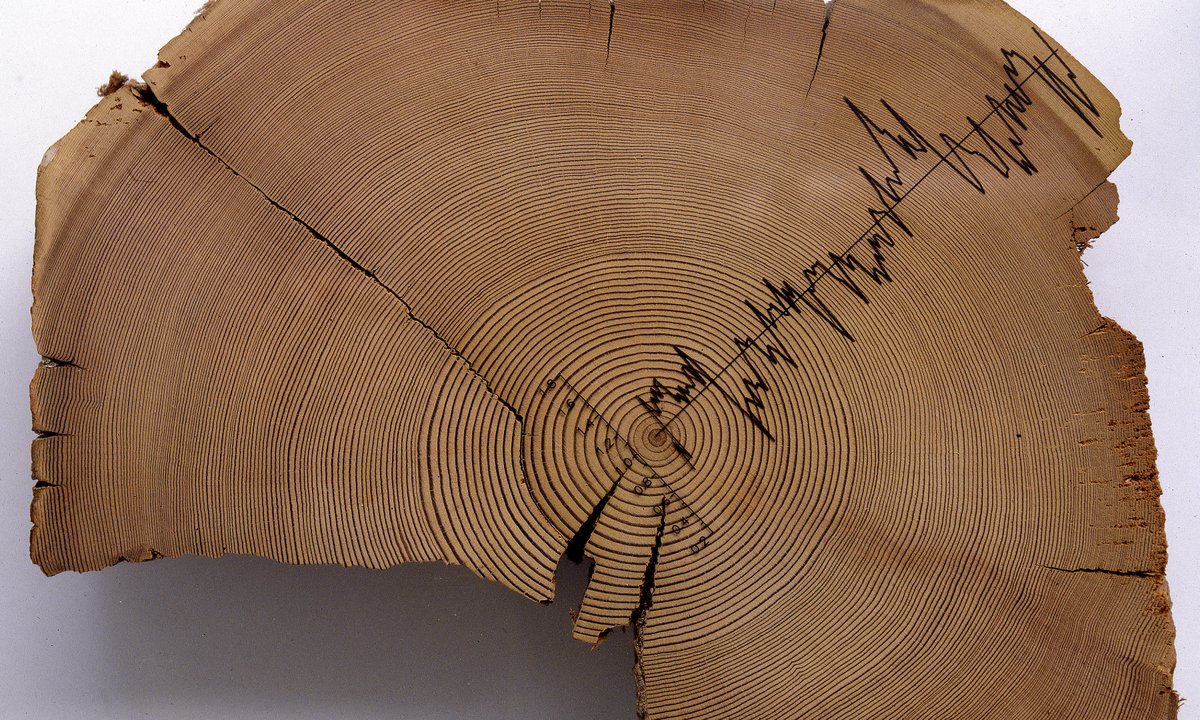„Ich gratuliere Anton Zeilinger herzlich zum Nobelpreis. Es ist eine große Stunde für die österreichische Physik, aber auch für die Universität Innsbruck, an deren Institut für Experimentalphysik Anton Zeilinger von 1990 bis 1999 forschte und lehrte und wo er mehrere der gewürdigten bahnbrechenden Experimente durchgeführt hat, so die erste Quantenteleportation mit Photonen im Jahr 1997“, freut sich Rektor Tilmann Märk.
Das Experiment zur Quantenteleportation war das erste, das den Quantenzustand eines Teilchens auf ein anderes Teilchen in der Distanz übertrug. Zeilingers Erfolge waren nicht zuletzt auch ein Grund dafür, die Quantenphysik in Innsbruck auszubauen und führten später zur Gründung des Akademie-Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation in Innsbruck und Wien. An der Universität Innsbruck forschen heute über 20 Arbeitsgruppen im Bereich der Quantenphysik, u.a. auch die Entwicklung des Quantencomputers betreffend.