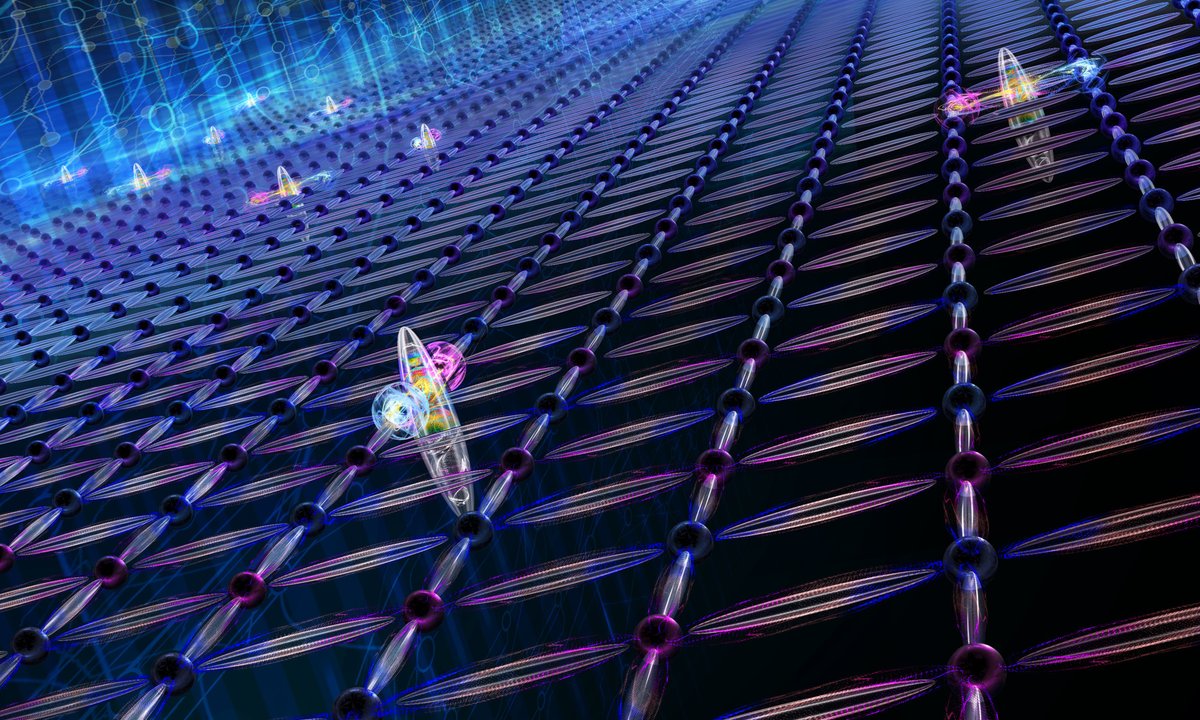Die Studie des Instituts für Erziehungswissenschaft fand im Sommersemester 2021 statt, als sich die Universitäten in Österreich im dritten aufeinanderfolgenden Semester mit mehrheitlich pandemiebedingtem Distanzlernen befanden. 913 Bachelor- und Masterstudierende aus verschiedenen Fakultäten der Universität Innsbruck nahmen an der Online-Befragung teil.
Die Wissenschaftler*innen um Alfred Berger zeigen, dass der Distanzunterricht an der Universität Innsbruck im Sommersemester 2021 vor dem Hintergrund einer mehrheitlich guten technischen Ausstattung der Studierenden und eines zum großen Teil recht gut funktionierenden Austausches zwischen Dozierenden und Studierenden stattfand. Die Studie weist allerdings auch auf einige mit dem Distanzlernen verbundene Schwierigkeiten hin. So wurde die Umstellung auf Distanzunterricht von mehr als der Hälfte der Studierenden als Belastung wahrgenommen und war mit Sorgen über die erfolgreiche Weiterführung des Studiums verbunden. Nur jeder zehnten befragten Person fiel das Distanzlernen leicht. Die große Mehrheit der Studierenden wünschte sich den Präsenzunterricht zurück.
Besondere Schwierigkeiten, ihren Lernalltag zu strukturieren und sich auf ihre Studienaufgaben zu konzentrieren, hatten Studierende, die während der Pandemie zu Hause über eine schlechte technische Ausstattung und Lernumgebung, eine geringe Lernmotivation, geringe Planungskompetenzen sowie eine unzureichende Unterstützung durch die Dozent*innen und Kommilition*innen verfügten.
Mit der Studie, zu der ein ausführlicher Bericht hier zu finden ist, werden Befürchtungen gestützt, die in der Bildungsforschung seit Beginn der Pandemie geäußert wurden und sich in Studien für die Volksschule und Sekundarschule zum Teil bereits bestätigt haben (z.B. Berger et al., 2021). Danach führte die Pandemie zu einer Vergrößerung bereits bestehender Unterschiede und Bildungsungleichheiten.
Die Autor*innen der Studie sind Univ.-Prof. Dr. Alfred Berger, Ass.-Prof.in Dr.in Gabriela Gniewosz, Johanna Jegg, BA., Mag. Wolfgang Hagleitner und Dr.in Susanne Roßnagl vom Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Innsbruck.