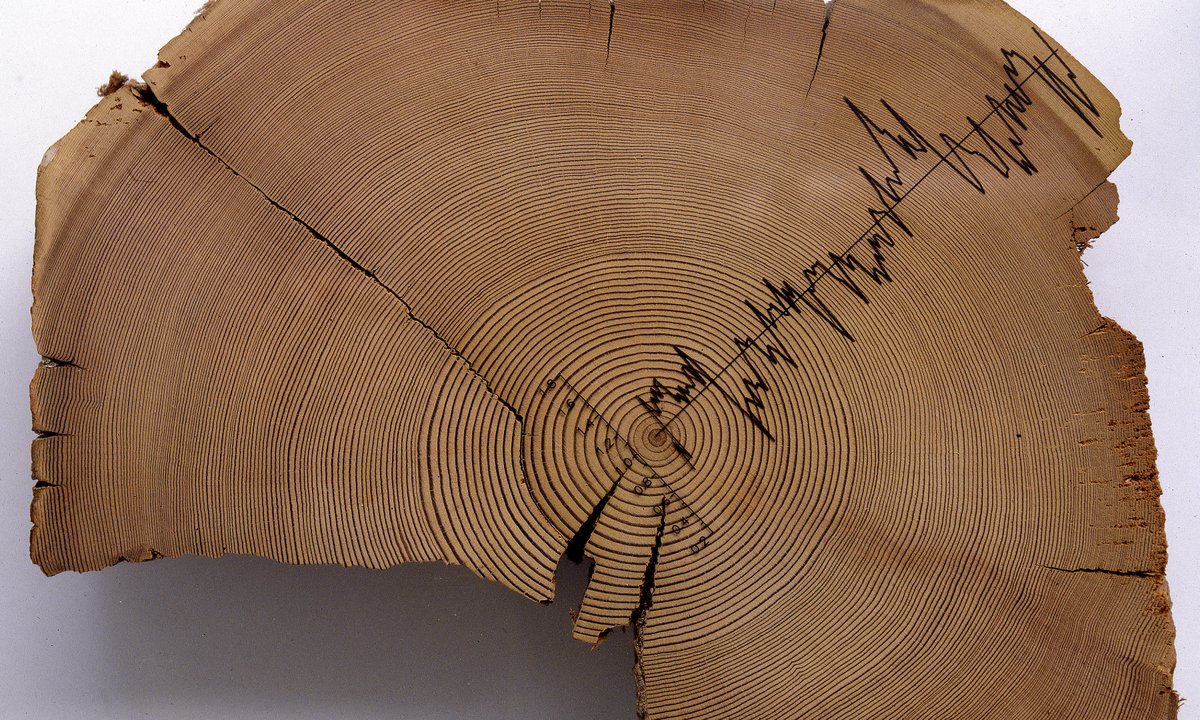Meroterpenoide bilden eine große Klasse von strukturell vielfältigen Naturstoffen, die aus einem hybriden biosynthetischen Weg stammen. „Bisher wurden über 100 Meroterpenoide aus Pilzen der Gattung Ganoderma isoliert, von denen mehrere Mitglieder eine Vielzahl von biologischen Aktivitäten und potenziellen therapeutischen Anwendungen zeigen“, erklärt Thomas Magauer, Universitätsprofessor für Organische Chemie an der Universität Innsbruck. Aufgrund ihrer antioxidativen, antitumoralen, entzündungshemmenden und antimikrobiellen Aktivitäten sind Ganoderma-Meroterpenoide attraktive Ziele für synthetische und pharmazeutische Chemiker. Überraschenderweise wurde zwar die Synthese vereinfachter Mitglieder bereits mehrfach erreicht, Ganoapplanin, eines der komplexesten Verwandten, konnte bisher jedoch noch nicht im Labor hergestellt werden. „Ganoapplanin wurde 2016 erstmals aus dem Pilz Ganoderma applanatum isoliert und weist in seiner molekularen Struktur ein einzigartiges polycyclisches Ringsystem mit mehreren Sauerstofffunktionen auf, was die Synthetisierung schwierig macht“, erklärt Magauer. Ein besonders bemerkenswerter Aspekt von Ganoapplanin ist seine Fähigkeit, CaV3-Subtyp-Kanäle (T-Typ) zu hemmen, die für Schrittmacheraktivitäten im Herzen und bestimmte Gehirnfunktionen wichtig sind. „Diese Eigenschaft macht Ganoapplanin zu einem potenziellen Leitstoff für die Entwicklung neuer Therapeutika gegen neurodegenerative Erkrankungen wie Epilepsie und Parkinson“, so Magauer.
Bahnbrechende Synthesestrategie
Für die aktuelle im renommierten Fachjournal Journal of the American Chemical Society veröffentlichte Arbeit entwickelten die Wissenschaftler eine modulare Synthesestrategie, die eine effiziente Kaskadenreaktion zwischen einem Terpenoid und einem aromatischen Fragment als Schlüsselschritt verwendet. „Dieser Ansatz ermöglichte den Aufbau des zentralen Kohlenstoffgerüsts der komplexen molekularen Architektur von Ganoapplanin in einem einzigen Schritt“, erklärt Thomas Magauer. Inspiriert durch die vermutete Biosynthese von Ganoapplanin, beinhaltete der Prozess eine außergewöhnliche intramolekulare radikalische Zyklisierung, gefolgt von einer intermolekularen Aldol Reaktion. Das verwendete Terpenoid Fragment wurde mittels einer Titan vermittelten Zyklisierung erhalten. Zwei selektive späte Oxidationen wurden für die abschließenden Syntheseschritte entwickelt.
Wirkung validieren
In einem weiteren Schritt will das Team um Thomas Magauer nun die entwickelte Synthesestrategie nutzen, um ausreichende Mengen von Ganoapplanin zu produzieren und die berichtete biologische Aktivität zu validieren. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Pharmazie und dem CavX-PhD-Programm der Universität Innsbruck wollen sie die Wechselwirkungen von Ganoapplanin mit verwandten spannungsgesteuerten Calciumkanälen weiter untersuchen.
Diese Forschungsarbeit wurde vom österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF), dem Tiroler Wissenschaftsfonds (TWF), dem Europäischen Forschungsrat im Rahmen des Horizon 2020 Forschungs- und Innovationsprogramms der Europäischen Union, dem Zentrum für Molekulare Biowissenschaften (CMBI) und der Experientia Stiftung finanziert.